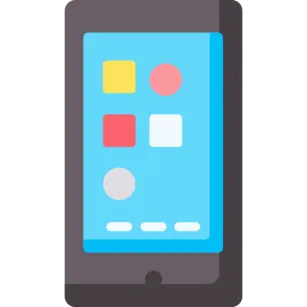Während der Vertretung in einer Landpraxis habe ich die Abende zusammen oft mit der Arztfrau verbracht. Ihre Kinder waren bereits aus dem Haus, das sie zusammen mit einem Kapuzineräffchen teilte. Nach der täglichen Sprechstunde war ich doch sehr geschafft. An einem unserer gemeinsamen Abende fing die Arztfrau an ungefragte Fragen zu beantworten. Warum ihr Mann so Hals-über-Kopf in Urlaub gefahren ist? Warum er mich als seinen Vertreter nicht einweisen konnte? Warum sie nicht mit ihm zusammen den Urlaub verbringt? Und auch warum sie seit über einem Jahr ein Beruhigungsmittel mit einem latinisierten Handelsnamen, der eingedeutscht etwa „zu den Schatten“ heißt, nehmen muss, um durch den Tag zu kommen. Sie erzählt: Ihr Mann, Dr. M. war Belegarzt für Chirurgie in dem kleinen Krankenhaus hier vor Ort. Er operierte die Bandbreite der kleinen bis mittleren Chirurgie und ist in der Bevölkerung und bei seinen Patienten sehr beliebt.
Dr. M. wollte bei einem 18-jährigen Mann einen Kleineingriff am Ellenbogen durchführen. Ich weiß auch gar nicht mehr was für ein Eingriff das sein sollte. Es spielt für den Ausgang der Geschichte auch keine Rolle. Jedenfalls setzt Herr Dr. M. die Anaesthesiespritze zum „Armplexus“. Die Injektion sitzt wohl nicht gut, denn es tritt auch nach der üblichen Wartezeit noch keine Schmerzunempfindlichkeit ein. Also lässt sich Dr. M. nochmals eine Spritze mit Anästhesielösung reichen. Die assistierende Schwester warnt Dr. M.: „Ich glaube, Herr Doktor, Sie haben schon fast die Höchstdosis injiziert. Muss man da nicht aufpassen?!“ „Bei dem jungen Mann passiert schon nichts“, meint Dr. M. und injiziert nach. Die Spritze fängt an zu wirken. Der junge Mann legt sich auf den Operationstisch hin und wird vorbereitet. Dr. M. beginnt das Operationsfeld zu desinfizieren und mit sterilen Tüchern abzudecken. Auf einmal ist es ganz ruhig. Der junge Mann rührt sich nicht mehr. Hektik bricht aus. Sein Herz schlägt nicht mehr. Dr. M. hat keine Erfahrung in Wiederbelebung. Wir schreiben das Jahr 1971. Für Wiederbelebung ist auch kein Set vorbereitet. Nichts ist da, kein Defibrillator, kein Intubationsbesteck, keine Beatmungshilfe, keine Notfallmedikamente.
Er versucht verzweifelt den jungen Mann selbst zu beatmen und Herzmassage durchzuführen. Es nützt nichts. Nach einer Stunde gibt der erschöpfte und verzweifelte Mediziner auf. Wenn ein junger Mann sozusagen gesund für einen Kleineingriff in ein Krankenhaus geht und stirbt, kann etwas nicht in Ordnung sein. Das festzustellen sagt der gesunde Menschenverstand. Die entsetzten Angehörigen erstatten Anzeige gegen den operierenden Belegarzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Es kommt zum Prozess. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Nichts wird beschönigt: Die Aussage der Krankenschwester, die ihn davor warnte die Höchstdosis des Betäubungsmittels zu überschreiten; Die fehlende Vorsorge für den eingetretenen Notfall. Zu seinen Gunsten spricht, dass Dr. M. für alle erkennbar unter dem Tod des jungen Mannes leidet. Er ist ein gebrochener Mann. Er versucht nichts zu verschleiern oder zu beschönigen. Er ist ein grundehrlicher und gläubiger Arzt. Im Strafprozess wird er vom Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Er darf seinen Beruf weiterführen. Ein Zivilprozess wartet noch auf ihn. Das Wort Schuld nistet sich in seiner Seele ein und lässt sich nicht ausmisten. Wie ein kleiner Tropfen Säure in einem Kleidungsstück - immer weiter und tiefer. In seinem Alltag ist nichts mehr so wie es mal war. In der großstadtnahen Marktgemeinde spricht sich der Prozessausgang herum wie ein Lauffeuer. Im Fadenkreuz der lokalen Presse fühlt er sich nicht nur gebrandmarkt, er ist es auch. Aber es kommt noch schlimmer für ihn: Zur damaligen Zeit war der Arzt auf dem Land Tag und Nacht für seine Patienten da. Offiziell teilte er sich zwar den Dienst wechselweise jeden zweiten Tag und jedes zweite Wochenende mit dem Kollegen am Ort. Aber das gilt eigentlich nur für Patienten, die noch nicht bei ihm waren. Seine Patienten konnten ihn immer erreichen. Deshalb halten sie ihm die Treue, deshalb verehren Sie ihn. Auch wegen seiner Ehrlichkeit. Seine Telefonnummer ist allen bekannt. Er ist immer erreichbar. Das ist okay, wenn man mit Leib und Seele Arzt ist. Daran kann man sich gewöhnen. Aber nicht an das, was ihn nun erwartet. Fast jede Nacht zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens klingelt das Telefon: Er ist es gewohnt ans Telefon zu gehen. Immer! Ohne Ausnahme, es könnte ja ein Notfall sein. Wenn er abhebt, meldet sich immer wieder dieselbe verstellte Stimme: „Mörder, Mööörder“ Und dann wird aufgelegt.
Dr. M. verfällt zusehends. Der Trigger „Mööörder“ ist der Säuretropfen, der den dünnen Schutzschild der Seele durchbrochen hat und weiter frisst. Zur damaligen Zeit konnte man den Anrufer noch nicht am Display seines Telefons erkennen. Man konnte sich gegen Telefonterror nur durch eine Anzeige bei der Polizei wehren, die dann eine sogenannte Fangschaltung einrichtete. Die Fangschaltung wurde dann auch - aber erst nach einer Wartezeit von einem Vierteljahr Terror - installiert. Nun frage ich Sie. Wenn Sie, verehrte Leserin und verehrter Leser nichts wissen außer dem was ich Ihnen gerade dargestellt habe – wer, glauben Sie war der nächtliche Anrufer? Die Mutter des verstorbenen jungen Mannes, vielleicht seine Freundin? Nein, weit gefehlt. Es war der Arztkollege am Ort! Natürlich gilt unser Mitleid dem jungen Mann, der aus Unachtsamkeit und wegen fehlender Vorsorge sein Leben verlor und seinen Angehörigen. Mein Mitleid gilt aber auch dem Chirurgen, der für den jungen Mann das Beste wollte und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände nun vor den Scherben seines Berufslebens steht. Er hat sein Tätigkeit an dem Krankenhaus sofort niedergelegt und nur noch eine Allgemeinpraxis betrieben. Er hatte Probleme, wie er in Zukunft mit seinem einzigen Kollegen am Ort mit dem er sich abwechselnd die Wochenenddienste teilt - umgehen soll. Er beschäftigt sich mit Philosophie und Psychologie. In seiner Praxis steht ein Bücherregal voll mit psychologischer und philosophischer Literatur neben üblichen Medizinwerken. All das bringt ihn nicht weiter. Vielleicht Ruhe in den Schweizer Bergen? ---- Mentale Pause, allein? Sollte er abschalten, neue Umgebung, andere Menschen? Einfach die Seele umtopfen, ihr neue Nahrung geben? Seine Frau ist ihm keine große Hilfe. Sie steht zu ihm, will ihm helfen, aber auch ihre Seele ist angefressen, Sie lebt ein Schattenleben, schon seit über einem Jahr steht sie unter einem Beruhigungsmittel aus der Diazepam Reihe mit dem latinisierten Namen „zu den Schatten“ wie eingangs erwähnt. Ich denke sie ist bereits abhängig. Erschrickt aus geringstem Anlass, ist unruhig. Sie fürchtet sich aus dem Haus zu gehen. Schließlich weiß man wer sie ist: Auf dem Land ist die Frau vom Doktor immer noch die Frau Doktor. Sie meidet den Blickkontakt mit Passanten als mögliche Mitwisser. In dieser Situation wollte er allein in Urlaub fahren. Der Trigger ist zwar weg, aber der Säuretropfen in der Seele ist noch nicht neutralisiert. Vielleicht gar nicht mehr bis morgen warten bis der Vertreter kommt? Der wird schon alleine zurechtkommen - meine Frau ist ja da und kann ihn einführen. Er nimmt seinen Jaguar X12 und fährt alleine los in die Schweiz. Am dritten Tag hat er einen kleinen Bagatellunfall. Auch das noch. Er verbringt den Jaguar zur Reparatur in eine Werkstatt und bittet seinen Sohn, der in der Schweiz studiert, telefonisch ihm sein Ersatzauto, einen Alfa zu bringen. Der Sohn macht das gerne und fährt nach der Übergabe mit dem Zug zurück. Ich habe ein schönes Zimmer im Wohnhaus der Arztfamilie neben der Praxis bezogen. Die Praxistätigkeit erstreckt sich meist bis nach neunzehn Uhr. Dann werde ich zum Abendbrot gebeten. Anschließend sitze ich noch mit der Arztfrau ein wenig zusammen und schaue mir die Nachrichten im Fernsehen an. Drei Wochen sollte ich bleiben. Es wurden über vier Monate.
Kennen Sie das auch? Haben Sie das auch schon mal erlebt? Ich sitze mit der Arztfrau abends im Wohnzimmer. Das Haustier der Arztfamilie, ein Kapuzineräffchen saust hin und her, zupft Haare aus dem Ohr der Arztfrau als es läutet. All die Abende zuvor hat es nie an der Haustüre geläutet. Das Telefon wohl, aber nie die Klingel. Tagsüber geht man zum Doktor, am Abend ruft man ihn an, so lautet die Regel auf dem Land. Ich schaue die Arztfrau an, sie schaut mich an. Und - ich weiß wer draußen steht. Mit absoluter Gewissheit. Und die Arztfrau weiß es auch. Ich sehe es ihrem Gesicht an. Die Arztfrau steht auf und geht zur Türe.  Meine Frau bei einem Besuch bei der Arztfrau mit dem Kapuzineräffchen am Rücken
Meine Frau bei einem Besuch bei der Arztfrau mit dem Kapuzineräffchen am Rücken
Auch der Affe spürt instinktiv, dass irgendetwas nicht stimmt; er fängt an wie irre zu kreischen und läuft wie wild im Kreis. Das bin ich von ihm nicht gewohnt. Nach ein paar Minuten kommt die Arztfrau weinend zurück: „Die Polizei hat mich gerade verständigt. Mein Mann ist tot, er hatte einen Verkehrsunfall“. Lange sitzen wir noch zusammen. „Meinen Sie, dass mein Mann Selbstmord gemacht hat? Mein Mann hat in letzter Zeit immer mal wieder über den Freitod gesprochen.“ „Nein, nein, warum sollte er. Er hat sich doch gerade erst den Ersatzwagen bringen lassen.“ „Aber der Polizist sagte, mein Mann habe auf einer absolut geraden Straße einen LKW überholt als von vorne weit sichtbar ein Sattelschlepper entgegenkam. Er hätte ihn sehen müssen. Warum hat er nicht gebremst?“ Ich versuche die Witwe zu beruhigen. Ich sage ihr, ich denke, dass ihr Mann meinte, er säße in seinem Jaguar und das Gaspedal durchdrückte. Der Alfa war nicht aufgemotzt. Er hat es einfach nicht bedacht. Aber im Inneren bin ich nicht überzeugt von dem was ich sage. Und Sie hat es meinem Gesicht wohl angesehen was ich wirklich dachte.
Ist Dr. M. mit dem Leben, mit seiner Schuld und vor allem der Verachtung seines einzigen Kollegen vor Ort nicht fertig geworden und hat als Freitod den Unfalltod gewählt? Entsprach das seiner Problemlösung? Fragen, die ich nicht wirklich beantworten kann und die ich ihnen deshalb selbst zur Beantwortung überlassen muss. Die Beerdigung und Trauerfeier fanden in der Schweiz statt. Die Arztwitwe gab dem Umfeld ihrer Gemeinde eine Mitschuld am Tode ihres Mannes und wollte sich nicht auf der Friedhofsbühne der Marktgemeinde zur Schau stellen. Nach den Regeln des Kassenrechtes durfte mich die Witwe noch ein Quartal – also drei Monate - über den Tod ihres Mannes hinaus beschäftigen. In dieser Zeit habe ich die Praxis bis zur Übernahme eines Nachfolgers weitergeführt und sie in ihrer Trauer begleitet.
Zahlreiche Angebote, die Praxis zu übernehmen habe ich abgelehnt. Eine Praxis übernehmen in einem Ort, wo der Kollegenneid möglicherweise zum Tode führt? – Nein, das wollte ich wirklich nicht. (ew)

Text im Bild: (Matthäus 7,3: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“)



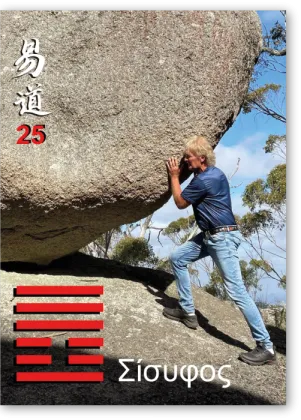






















 Und dann zum Startbildschirm hinzufügen.
Und dann zum Startbildschirm hinzufügen.