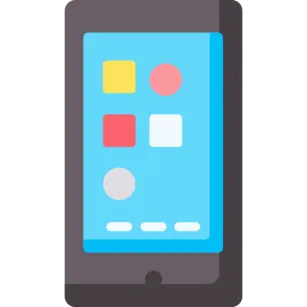Mittlerweile ist es 50 Jahre her. Aber es bewegt mich immer noch, hat mich zum Nachdenken gebracht und ein Leben lang begleitet.
Ich war an einem Sonntag als junger Arzt im „Kassenärztlichen Notdienst München“ zum Dienst eingeteilt. Dabei werde ich über eine Zentrale mit dem Funktaxi von Notfallpatient zu Notfallpatient weitergeleitet. Der Arzt sollte in einem Zeitfenster von einer halben Stunde beim Patienten sein. Damit fielen im Prinzip alle lebensbedrohlich erkrankten Patienten aus dem Raster. Für die ist auch heute noch der Notarzt in einem Klinikstandort in Kooperation mit der Berufsfeuerwehr zuständig. Ich wurde zu einem Patienten in München-Bogenhausen gerufen, gutbürgerliche Villengegend. Die Familie mit Mutter, zwei erwachsenen Kindern, Sohn und Tochter erwarten mich bereits an der Haustüre. Der Sohn stellte sich vor und sprach mich an. Der Vater habe Schmerzen, er liege im Wohnzimmer und brauche eine Schmerzspritze.
Unklare Schmerzen
Ein etwa 55-jähriger, völlig abgemagerter Mann liegt auf der Couch und schaut mich an. Er hatte ein auffallend gelbes Hautkolorit und vor allem die Augen ganz gelb gefärbt. Er klagt über starke Schmerzen, ich möge ihm doch bitte rasch eine Schmerzspritze – am besten Morphium verabreichen. Meine Diagnosegedanken kreisen um Leberentzündung, Gallenwege-verschluss oder Tumor. Also frage ich ihn, ob ich ihn untersuchen dürfe. Ja, das sei schon okay. Aber ich merke, dass es ihm nicht so sehr um eine Diagnose ging, sondern darum, dass ich ihm Erleichterung verschaffen möge. Gerade im Notdienst, wenn ich einen mir unbekannten Patienten vor mir ohne Vorbefunde habe, gilt die Regel: Erst gründlich untersuchen, Verdachtsdiagnose stellen, dann entscheiden und behandeln. Ich stellte einen Trommelbauch und hochgestellte Darmgeräusche fest, die man dann findet, wenn ein Stopp im Darm ist. Das heißt es geht nichts mehr durch, es besteht ein Darmverschluss. Offenbar eine Komplikation der Gelbsucht.
Sollte er nicht in die Klinik? Also sage ich zu dem Patienten: „Ich weiß nicht genau, was mit Ihnen los ist. Aber so viel ist sicher. Sie haben einen Darmverschluss und außerdem Gelbsucht. Ich muss Sie ins Krankenhaus einweisen, ambulant kann ich das nicht behandeln“.
„Ach Herr Doktor“, sagte darauf der Patient. „Vielleicht hätte ich es Ihnen ja auch gleich sagen sollen: Ich habe einen Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Der Tumor hat die Organgrenzen überschritten und bedrängt die Nachbarorgane. Und ich habe einfach Schmerzen. Jetzt helfen Sie mir halt“.
Tumorschmerzen im Endstadium
„Aber wenn Sie jetzt nicht ins Krankenhaus gehen, wird es Probleme mit ihrem Darmverschluss geben“, antwortete ich. „Ja, das weiß ich“, sagte er, „das habe ich alles mit meinem Hausarzt so besprochen. Können Sie mir denn sagen, was das Krankenhaus, in das Sie mich einweisen wollen, mit mir noch machen kann? Ich bin inoperabel, der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist so weit fortgeschritten, dass er bereits die Lebergänge einengt. Ich will zu Hause bei meiner Familie und in Würde sterben - wir haben das alle gemeinsam so besprochen“.
Familiäre Aura der Empathie
Und die gesamte Familie, Frau, erwachsene Kinder - Sohn und Tochter - standen um mich und den Vater im „Kranken“-zimmer.
„Jetzt geben Sie mir schon meine Schmerzspritze, wie lange soll ich denn noch warten?“
Als junger Arzt stehe ich ihm in dieser Situation relativ hilflos gegenüber. Das haben wir weder im Studium noch in der weiteren Ausbildung gelernt. Ich will doch helfen, Leben retten, also beginne ich noch einmal:
„Aber man kann doch noch eine Darmentlastung mit einem künstlichen Ausgang anlegen. Wenn Sie das nicht machen lassen werden Sie in drei bis vier Tagen sterben“.
„Wozu denn das, damit ich vielleicht noch ein oder zwei Wochen länger leide? Nein, ich habe das mit meiner Frau und meinen Kindern besprochen, ich möchte das nicht“.
Ich bin von einer Aura der Empathie der Familie umgeben und fange an zu begreifen, was hier zu tun ist. Wortlos nicke ich freundlich zu meinem Notfallpatienten und bediene mich aus meinem Notfallkoffer.
So etwas hatte ich zuvor noch nie erlebt. Die Ehrlichkeit mit der in dieser Familie miteinander umgegangen wird. Mit dem Sterben, mit dem Tod. Kein schnelles Abschieben ins Krankenhaus um der emotional aufwühlenden Situation des Sterbevorganges zu entgehen. Kein Abschieben ins Hospiz und wenn er noch so gut dort aufgehoben wäre. Kein Doktor-Patienten-Lügengespräch: „Geht es Ihnen schon besser, das wird schon wieder.“ Ich spürte nicht Trauer im Zimmer sondern einfach nur gegenseitige Achtung, Zuneigung und Liebe.
Ich habe ihm seine starke Schmerzspritze verabreicht. Nachdenklich verabschiede ich mich von meinem Notfallpatienten und seiner Familie. Eigentlich hat dieser Todkranke mich behandelt. Er hat mir viel von meiner ärztlichen Hybris genommen und mir Dinge gelehrt, die ich nie vergessen habe.

Fünf Tage später habe ich in der Zeitung seine Todesanzeige gelesen. Ich denke oft an ihn.
So würde ich auch von der Welt gehen wollen, wenn es denn schon sein muss. Nicht im Hospiz, nicht anonym, nicht im Krankenhaus: Im Kreise derer, die mich vermissen werden und die ich liebe, eben im Kreise meiner Familie.
Was immer du tust, handele klug
und bedenke das Ende
[1] Altrömischer Sinnspruch
Papaver somniferum. Schlafmohn.
Grundlage zur Gewinnung des
Schmerzmittels Opium / Morphium.



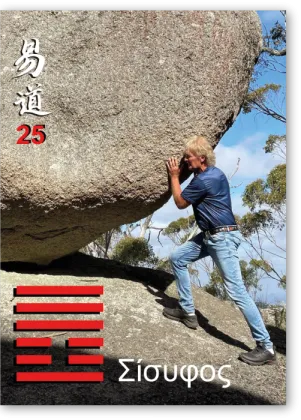





















 Und dann zum Startbildschirm hinzufügen.
Und dann zum Startbildschirm hinzufügen.